Romane
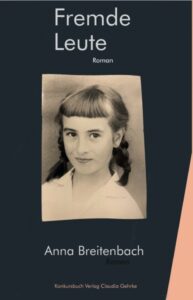
Fremde Leute – Roman – Neuausgabe 2025 im Konkursbuch Verlag Claudia Gehrke, Tübingen
Klappentext:
Drei Personen: der Vater, die Mutter, das Kind. Erzählt aus dem Blick des Mädchens. Es erinnert, imaginiert, beschwört ein prekäres Beziehungsdreieck, in dem alle Opfer und Täter/Täterin zugleich sind. In knappen Szenen, die plastische Bilder erzeugen, Kurzfilme, erschreckend und schön. Eine Kindheits-/Jugendgeschichte mit offenem Ende. Daheim ist erster Stock links. Und Krieg zwischen den Eltern. Der wird härter. Das Mädchen zwischen den Fronten. Es beobachtet, versucht zu helfen, angeklagt als Verräterin. Es entdeckt aber auch Lustvolles. Dazwischen in Momentaufnahmen das Leben der Eltern, Kriegserfahrungen und Traumata, die in die Gegenwart und die nächste Generation hineinwirken. Im Anhang erzählen die „Kleinen Jahre“ mit einem bildhaften Blick von der Zeit vor Beginn des Romans, den ersten Lebensjahren des Mädchens im Dorf.
Barbara – Lest es! Bewertet am 13. Mai 2025
Ich würde das Buch gerne auswendig lernen. Damit ich keinen wichtigen Satz davon verliere. Es besteht nur aus wichtigen Sätzen. Kaum fing ich mit dem Lesen an, schon hat es mich in meine eigene Kindheit zurück katapultiert und ich habe alles mit meinen Kinderaugen gelesen. Das war so unbeschreibbar aufregend. Ich hab mich heimlich mit gefreut, hatte oft auch Angst und hab so viel im Nachhinein nacherlebt. Durch dieses Buch. Lest es, Frauen, Mütter, Männer … es ist ein Juwel!
Es hat mich wirklich aufgewühlt, diese kurzen, fast sachlich gehaltenen Sätze, die voller Untiefen waren. Du liest das und schon rotieren Gehirn und Gefühl.
Eva S. – Herzschrittmacher Bewertet am 16. Mai 2025
Ich hab das Buch einfach auf meinen Schoß gelegt und eine der ersten Seiten aufgeschlagen. Und schon ging’s los. Gefühlt hab ich keinen einzigen Satz gelesen, der nicht sofort den Puls erhöht hat. Es muss an dieser Art des Schreibens liegen. Da steht was, aber hinter den Buchstaben öffnet sich eine ganz andere Welt. Verrückt.
Frank – Zurecht mit einem Buchpreis ausgezeichnet. Bewertet am 18. Mai 2025
Anna Breitenbachs klare, schnörkellose Sprache hat eine absolute Sogwirkung. Man fühlt sich direkt in ihre Kindheit versetzt, als würde man neben ihr auf dem Sofa sitzen. Ein Buch, das man nicht aus der Hand legen kann. Unbedingt lesen!
Elisa – Den Ton getroffen. Wunderbar! Bewertet am 12. Mai 2025
Hab das Buch leider schon ausgelesen, ich hätte auch noch weitergelesen, wenn da noch mehr Seiten gekommen wären. Es ist wunderbar. Du triffst den Ton. Großes Kompliment!“
Originalausgabe (Vergriffen):
Fremde Leute
Meine Mutter zog abends, wenn sie schlafen ging, den Vorhang schon auf. Dann konnte sie schlafen, solange sie wollte. Das ging keinen was an.
Als sie klingelte, wußten wir noch nicht, daß sie es war. Sie wohnte am anderen Ende der Stadt. In einem eigenen Haus. Wir wohnten auf dem Berg, in einer Straße, in der die Häuser sechs Wohnungen hatten und sechs Balkone. Wir hatten die Wohnung im ersten Stock links. Und die hatten wir, weil mein Vater Beamter war. Es war eine Beamtenwohnung.
Stand da und klingelte, frech. Sagte meine Mutter. Als sie schon wußte, daß sie es war. Es waren Ferien. Wir hatten noch geschlafen, die Vorhänge offen. Meine Mutter hatte gleich gesagt: Wir melden uns einfach nicht. Wir waren im Bett geblieben.
Ich schlief mit meiner Mutter im Doppelbett. Ich links und sie rechts. Vorher hatte mein Vater links geschlafen. Das Schlafzimmer war ein Meisterstück. Wurzelholz, poliert. Die Lampe war eine zarte Schale mit Apfelblüten. Wenn ich im Bett lag, habe ich immer auf diese blaßroten Apfelblüten gesehen.
Mein Vater schlief in meinem Kinderzimmer. Ich hatte kein Kinderzimmer mehr. Ich hatte es nur kurz. Dann war mein Vater in mein Kinderzimmer gezogen. Aber es hieß immer noch: das Kinderzimmer. All die Jahre lang. Bis ich groß war und ausgezogen bin. Auch danach hieß es noch: das Kinderzimmer.
Sie klingelte. Wir wußten noch nicht, daß sie es war. Sie war meine beste Freundin, in der Schule. Daß sie Dagmar hieß, paßte zu ihr. Es klang vornehm. Ihr Vater war Zahnarzt. Und sie hatte einige Sachen, die ich nicht hatte. Zum Beispiel Fenstertiere aus Plastikfolie in verschiedenen Farben, die man abziehen und woanders wieder hinkleben konnte.
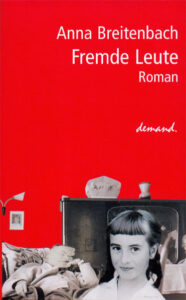
Sie klingelte. Meine Mutter stieg aus dem Bett und schlich zur Tür. Sie drückte die Türklinke herunter, fast ohne Geräusch. Und sah vorsichtig um die Ecke. Unsere Wohnungstür, sie hieß: die Entreetür, hatte in der Mitte Glas, längsgestreiftes Glas und einen gespannten Vorhang. Aber man konnte trotzdem etwas sehen.
Sie klingelte. Und fing an zu rufen, nach mir. Da wußten wir, daß sie es war. Und daß sie mit mir spielen wollte, den ganzen Tag. Es waren Ferien. Und daß ihr Vater sie hochgefahren hatte. Und daß er den Berg wieder runtergefahren war.
Meine Mutter sagte: Wir machen einfach nicht auf. Dann geht sie schon wieder. Meine Mutter wollte nicht, daß jemand wußte, daß sie noch im Nachthemd war. Meine Mutter wollte nicht, daß jemand etwas von uns wußte. Meine Mutter hatte nicht gern fremde Leute im Haus. Mein Vater auch nicht. Zu mir kamen keine Kinder. Sie wußten das.
Sie klingelte. Sie ging nicht wieder. Sie blieb einfach stehen, vor unserer Tür. Vielleicht hatte sie sich hingehockt. Sie wollte einfach nicht den ganzen Berg wieder runterlaufen. Sie klopfte, an die Tür. Sie klingelte, ganz lange.
Meine Mutter wollte in die Stadt. Sie ging gern in die Stadt, einkaufen. Diesen Vormittag wollte sie in die Stadt. Sie fing an, sich anzuziehen, leise. Ich zog mich auch an. Sie öffnete langsam, fast ohne Geräusch, die Schlafzimmertür, duck dich! und kroch, so flach wie möglich, über den Flur, ins Badezimmer. Ganz langsam. Fast ohne ein Geräusch zu machen. Ich kroch hinterher.
Wir ließen das Wasser nur ganz dünn laufen. Zum Gesichtwaschen, Zähneputzen. Dann krochen wir wieder zurück, ins Schlafzimmer.
Meine Mutter saß auf dem Bett. Wir können jetzt nicht mehr aufmachen! Sie klingelte. Die Abstände wurden größer. Sie klingelte nicht mehr.
Wir saßen beide auf dem Bett. Wenn wir jetzt nicht gehen, brauchen wir gar nicht mehr zu gehen! Meine Mutter wollte in die Stadt.
Meine Mutter stand im Flur, an der Garderobe. Sie hatte den Schlüssel in der Hand, ihre Tasche. Sie machte die Entreetür auf. Wir gingen durch die offene Tür. Es roch wie sonst auch. Die geputzte Steintreppe, das glatt schwarze Geländer. An der Seite stand Dagmar. Wir gingen an ihr vorbei. Die Treppe runter. Die Haustür schlug immer von alleine zu.
Doppeladler
Ich lag mit meinem Vater in seinem Bett. Ich lag gern mit meinem Vater in seinem Bett. Als es noch sein Bett war. Heirate du doch deinen Vater, sagte meine Mutter immer. Wenn sie nicht sagte: du und dein Vater.
Ich lag in seinem Arm, und sein Arm war schwarz. So schwarz wie seine Brust, seine Schultern, seine Beine. Mein Vater hatte ein schönes schwarzes Fell, und es war ganz weich. Wahrscheinlich war es von dem Fell auch so schön warm in seinem Arm.
Es war Sonntagmorgen. Ich lag mit meinem Vater in seinem Bett, und wir spielten: Ich sehe was, was du nicht siehst. Meine Mutter sahen wir nicht. Sie lag in ihrem Bett. Oder war schon aufgestanden.
Wir sahen das blasse Rot der Apfelblüten auf der Lampe über uns. Wir sahen das Silber der drei Spiegel der Kommode in der Ecke. Sie hieß: die Frisierkommode. Wir sahen das zarte Gelb der Lilie, die grade aus ihren Blütenblättern kam. Die Lilie, die mein Großvater gemalt hatte, auf goldenem Grund. Mein Vater sah, was ich sah.
Wir sahen bis zur Wand mit dem Schwarz des Ofengitters, durch das im Winter die warme Luft kam. Wir sahen bis zur Wand mit dem Braun vom großen Schrank, Wurzelholz, poliert. Wir sahen bis zum Fenster, mit den roten und grünen Kästchen im Muster der Vorhänge. Die schon offen waren.
Ich lag mit meinem Vater in seinem Bett. Mein Vater hielt mich in seinem Arm. Ich hatte meine Hand auf seine Hand gelegt, auf seine schwarze Hand. Sogar auf den Fingern hatte er kleine haarige Inseln. Und der Zeigefinger hatte einen verkrüppelten Nagel. Den fühlte ich immer an.
Da sagte mein Vater: Wir spielen ein neues Spiel. Es heißt Doppeladler. Du legst dich auf die Seite, und ich leg mich auf die Seite. Rücken an Rücken. Von oben sehen wir dann aus wie ein Adler. Müssen wir die Arme wegstrecken? dachte ich. Ich wollte wissen, wie das Spiel weitergeht. Wenn du zu mir ins Bett kommst, werden wir jetzt immer so liegen. Sagte mein Vater. Du bist doch schon ein großes Mädchen.
Königs Kind

Manchmal fuhren wir über Land. Wenn wir meine Schwester besuchten. Die verheiratet war.
Wir fuhren in dem großen Mercedes, den mein Vater vom Landrat gekauft hatte, gebraucht. Es war der Dienstmercedes vom Landrat. In dem sein Chauffeur ihn herumgefahren hatte. Es war: der Dienstwagen. Er war so vornehm, wie die Farbe klang: beige.
Manchmal fuhren wir mit ihm über Land. Ich saß hinten und war eine Prinzessin. In ihrem Wagen.
Auf dem Weg zu dem Schloß meiner Schwester waren viele Dörfer. Wenn die Dorfbewohner vor ihren Häusern standen, am Straßenrand, dann grüßte ich sie, majestätisch.
Die Hand einer Prinzessin ist klein und weiß. Sie winkt nicht. Sie grüßt, leicht. Und stolz. Und mit einer zierlichen Neigung des edlen Kopfes.
Eine Prinzessin hat einen schönen, mächtigen Vater und eine schöne, liebevolle Mutter. Eine Prinzessin hat ein schönes Leben. Eine Prinzessin hat alles Glück dieser Welt. Und viel Geld. Eine Prinzessin ist nicht unglücklich. Eine Prinzessin lächelt, immer.
Manchmal hatte ich die Spitzenhandschuhe meiner Mutter dabei. Das war auch gut.
Auf dem Rückweg im Dunkeln schlief ich auf der Rückbank. Wenn ich nicht eine Sängerin war und sang. Lied an Lied. Wenn ich nicht kotzen mußte. Der Weg zu meiner Schwester hatte viele Kurven.
Herr Kühl
Wir bekamen einen neuen Freund ins Haus. Wir hatten noch nie einen gehabt. Ich würde am meisten mit ihm befreundet sein. Ich würde die wunderbarsten Sachen mit ihm machen. Ich hatte mir alles schon gut überlegt.
Schoko auf jeden Fall, und Erdbeer. Mit den Beuteln von Dr. Oetker. Ich hatte sie schon da. Einmal Schoko, einmal Erdbeer und einmal Vanille. Ich hatte so oft schon gelesen, wie man’s machen mußte.
Er kam immer noch nicht. Montag hätte er kommen sollen, Dienstag.
Er kam in die Küche. Links zwischen den Küchenschrank und den Tisch vorm Fenster. Der war eine l ange Platte, die fest in der Wand war. Es war: der Fenstertisch. An dem meine Mutter alles machte.
Über dem Fenstertisch war: das Fensterbrett. Da saß ich immer, wenn meine Mutter am Fenstertisch was machte. Ein Huhn ausnehmen oder einen Fisch. Oder Teig in der großen Schüssel.
Meine Mutter sagte immer, wenn sie Kuchen backen wollte: Gib mir mal die große Schüssell! Wenn ich nicht schon oben saß, die Füße auf dem Fenstertisch.
Die ganze Hand meiner Mutter verschwand in dem Huhn. Und kam mit allem wieder heraus. Kleinere Sachen holte sie mit dem krummen Finger hinterher. Da lag alles, was drin gewesen war.
Meine Mutter sagte: Innereien. Meine Mutter machte alles Fett weg. Meine Mutter schnitt dem Huhn die Flügel ab und den Hals. Alles für die Suppe. Meine Mutter nahm eins nach dem andern in die Hand und hielt es unter fließendes Wasser. Ich sah, wie die Blutklümpchen aus dem Herzen gespült wurden. Die Leber hielt meine Mutter gut zusammen, damit der Wasserstrahl sie nicht zerriß. Der Magen mußte erst saubergemacht werden.
Ich sah all die gelben Körnchen, die das Huhn noch gefressen hatte. Meine Mutter stülpte den Magen um und zog die Haut ab. Meine Mutter sagte: Regenbogenhaut. Sie hatte wirklich alle Farben.
Meine Mutter hatte schöne Hände. Hände mit Kraft. Ihre blonde Haut war leicht gebräunt. Wenn ich auf dem Fensterbrett saß, sah ich immer auf diese Hände. Wie sie machten, was meine Mutter wollte.
Kleingeschnitten mochte ich den Magen in der Suppe am liebsten. Er schmeckte so schön fest. Die Leber war mehlig im Mund. Und schmeckte zu viel nach Leber. Mein Vater sagte immer: Gib dem Kind das Herz! Aber wenn es so klein in meiner Suppe lag, sah es so klein aus. Und ich konnte es nicht essen. Meistens nahm es dann mein Vater in seine Suppe.
Männer brachten ihn herauf und durch die Entreetür herein. Vorsichtig! Vorsichtig! wollte ich dauernd rufen. Keine Ecken anschlagen! Er sah so wunderbar aus. So weiß, so kühl und glatt.
Er kam zwischen den Küchenschrank und den Fenstertisch. Und er paßte genau. Und die Tür ging auf und ganz leicht wieder zu. Und hielt von selbst.
Ich hatte ihm einen Namen gegeben. Unter uns nannte ich ihn: Eisikünk. Wenn ich nicht zu besonderen Gelegenheiten: Herr Kühl sagte. Und wenn ich ihn auf und zu machte, redete ich mit ihm, daß er wußte, ich war‘s.
Am allerliebsten machte ich alle drei Sorten auf einmal. Bis es Cassata gab. Auf einmal gab es Cassata bei Dr. Oetker. Cassata, mit bunten Stückchen. Sehr italienisch. Und man mußte zwischendurch rühren, daß die Stückchen nachher nicht alle unten waren.
Ich war viel in der Küche. Und redete mit ihm. Wenn meine Mutter und mein Vater im Wohnzimmer waren. Ich rede nicht mit deinem Vater, sagte meine Mutter immer. Und: Sag deinem Vater…! Wenn er neben ihr stand und sie was von ihm wollte.
Ich setzte mich auf den Boden, lehnte mich mit meinem Rücken an ihn. Er brummte freundlich. Im Wohnzimmer war es still.
Laudatio: Ach wäre „Der Himmel über mir, blau“ (Thaddäus Troll-Preis 2001)

Meine Damen und Herren,
zu ehrende Preisträgerin,
mit zu ehrender Preis-Stifter Förderkreis,
mit zu ehrende Jury,
mit zu ehrender Verleger,
das Nötige vorweg:
„Ich ist ein anderer“ – Anna Breitenbach ist auch Hilga Wesle. Hilga Wesle ist studierte Literatur- und Politikwissenschaftlerin, ist ausgebildete Jounalistin, ist Lyrikerin, ist Prosaistin, ist Kabarettschreiberin, ist Esslingerin und Italienerin. Und ist ein Jahr vor dem deutsch-deutschen 17. Juni, der uns einmal einen Feiertag bescherte, geboren, also – Hätten Sie es noch gewußt? – 1952.
Und nun zurück zu Anna Breitenbach und ihrem zurecht preisgekrönten Roman „Fremde Leute“ – kurz nur. Sich mit einem Roman zu beschäftigen, solle, so Uwe Johnson, so viel Zeit brauchen, wie es gebraucht habe, ihn zu schreiben. Pardon, Anna Breitenbach, in Das Erzählen aus der Kinderperspektive nennt die Literaturwissenschaft „inszenierte Naivität“. Ein erzählerischer Kunstgriff, mit dem Gewohntes fremd gemacht, das erwachsene Realitätsprinzip dem wilden Blick konfrontiert werden soll. Meister „inszenierter Naivität“ sind etwa Günter Grass, Walter Kempowski und Gisela Elsner. Groteskisierung, Komisierung der Erwachsenenwelt ist die Absicht.
Eine andere Meisterin ist Anna Breitenbach. Bei ihr wird die große Welt nicht aus der kindlichen Sicht nur zum Kuriosum. Auch, die familiären Rituale werden komisiert – aber das Kind ist nicht nur Opfer der Paranoia des Vaters und der Todtraurigkeit der Mutter und beider Einsamkeit. Das Kind ist auch Sympathisantin. Vieles ist komisch, vieles ist traurig, manches ist „wunderbar“ in dieser Triade von Mutter, Vater, Kind. Der kindliche Blick karikiert die Familie nicht, sondern macht sie komplex. Alle haben sehr gemischte Gefühle, sind melancholisch und möchten das Gegenteil sein. Erzähltechnisch inszeniert wird zwar eine Naivität, ein erinnerter Blick eines Mädchens, das zu Beginn des Romans unbestimmt alt ist, später Konfirmandin, zum Schluß studiert es. Erzählerisch inszeniert wird der Blick eines Kunstmädchens, das naiv ist in seiner Magie der Phantasie und zugleich alt, das verstört, befremdet auf die Eltern schauen kann, aber auch lieb und mitleidig. Die „inszenierte Naivität“ ist bei Anna Breitenbach nicht entwicklungspsychologisch streng fixierte Untersicht, Gegenperspektive. Es wird vielmehr aus mehreren Blickwinkeln erzählt, die das Spektrum des Kind-Eltern- Verhältnisses bis zum Verlassen des Elternhauses umfassen. In die „inszenierte Naivität“ des Mädchens, der jungen Frau zugleich die Emotionen einflechten zu können, die sich in erwachsener Erinnerung einstellen, also nicht eine jugendliche und pubertäre Perspektive festzuschrauben, wird dem komplexen Erinnern gerecht und finde ich eine erzählerische und menschliche Leistung.
„Fremde Leute“ ist kein autobiographisch angelegter Roman, er ist schwer nachrechenbar. Und wenn doch, weil alle Literatur gewiß immer auch die AutorIn beschreibt, ihre Manier, die wirkliche und mögliche Welt zu gestalten, dann sage ich mit der Mutter: „Macht nichts, wenn ich nicht sage: Das geht einen nichts an!“ Damit variiere ich eine häufige Stilfigur der Erzählerin, die im Original zum Beispiel so lautet: Das Kind und der Vater spielen Pingpong am Wohnzimmertisch – und:
„Mein Vater holte den Ball aus den Blumen, von der Fensterbank. Ich holte den Ball unter dem Sofa raus. Mein Vater holte ihn hinter dem Fernseher raus. (…) Kinder, Kinder, sagte meine Mutter. Wenn sie nicht sagte: Ihr tötet mir noch den letzten Nerv.“ (S. 144)
Daran läßt sich die Formulierungskunst von Breitenbach beobachten, die geschult ist an den Verknappungs- und Komisierungsverfahren insbesondere der österreichischen Literatur, von der wir alle so viel gelernt haben: Mit Wiederholungen, Umschreibung von Wiederholungen, mit knappen Sätzen, mit komischen Aussparungen, mit impliziten Anund Vorausdeutungen, mit einer offenen Szenenreihung folgt die ritualisierte Sprache den Ritualisierungen des Lebens und seines Erlebens. Solche wiederholenden und variie-renden Hauptsatzkombinationen legen das Gerippe des Verhaltens frei – ohne psychologisch weitschweifige Erklärungen.
Das ist abstrahierende Darstellung, nicht autobiographisches Nachschreiben. Das Kind hat keinen Namen, es ist „das Kind“, eine Nachzüglerin, die drei Geschwister tauchen zwar nicht unwichtig auf, bleiben aber undeutlich. Es geht um ein Modell, eine komponierte Summierung von Situationen dieser Triade Mutter, Vater, das Kind. Nur indirekt sind Lokalisierung und die zeitliche Situierung des Romans zu erschließen. Es scheint sich um eine oberhessische Kreisstadt an der Werra zu handeln. Details wie „Nimm 2“ und die Fernsehsendungen lassen auf die Mitte der Sechziger Jahre schließen. Mehr autobiographische Genauigkeit will der Roman nicht. Der Familie wird ihr Geheimnis nicht entrissen. Aber eine ganz exakte Angabe gibt es doch: Am 21. 9. 1939 beobachtet der Vater in Schlesien den Einmarsch nach Polen, den Beginn des Zweiten Weltkrieges. Das bestärkt die Vermutung, daß es „Fremde Leute“ nicht um eine Autobiographie zu tun ist, sondern um ein Muster der (klein-)bürgerlichen Familie, einer sehr deutschen, einer Flüchtlings- und dann westdeutschen Nachkriegsfamilie.
Ein Modell erzählen, heißt, daß da jemand bewußt komponiert, Typisches in summarisch titulierten Kurzkapiteln arrangiert. Durch das inszenierte naive Kind greift eine Erzählerin auf den Stoff, das mag Anna Breitenbach sein, das mag das erwachsen gewordene, der Familie in ihre Ruhe entkommene Kind sein, das statt zu studieren sich in der narzißtische Schreibglocke verhaust. „Fremde Leute“ ist kein nacherlebbarer Illusions-Roman über die Sechziger Jahre, so amüsant und betreten wiedererkennbar viele seiner Szenen sind. Er ist ein bewußt gemachtes Kaleidoskop von Fragmenten erinnerter Vergangenheit, in das mit kurzen Zwischenabschnitten die Vorgeschichten der Großeltern und Eltern geschnitten sind. Nicht nur das kindliche, pubertäre Erleben der Sechziger wird erzählt, sondern auch die Verheerungen, die sich fortsetzenden Familiendramen, die Krieg, Flucht, Kriegsfolgen in die Familie, die unter den Normen der alten Bürgerlichkeit angetreten ist, geschlagen und die Eltern in ihrem Selbstverständnis und Zusammenleben vernichtet haben. So wirft das erzählerische Modellieren in „Fremde Leute“ ein doppeltes Problem auf: Nämlich einmal das, inwieweit Generationen sich generell dadurch unterscheiden, daß die ältere nur auf abgeschlossene, nicht mehr revidierbare, sie einzwingende Geschichten zurücksieht, die jüngere hingegen sich offene, gestaltbare Geschichten, Lebenspläne entwirft; und zum andern das genuin deutsche Problem, daß nämlich die alle Biographien umwerfende Gewalt des Krieges, seiner Gründe, wie ein Schatten auf allen Planungen der Nachkriegs-Kinder liegt, die zum Hoffen auf eigene Lebensgestaltung das erfahrene Mißlingen hinzufügt. „Fremde Leute“ inszeniert nicht allein das kindliche Erleben einer Familie der Sechziger Jahre, einer kulturellen Umbruchzeit, sondern auch das Räsonnement über deutsche Schicksale und der Entrinnungsmöglichkeiten.
Einen Roman soll man lesen, sich von ihm gefangen nehmen lassen. Von einem Roman soll man nicht sagen, was eigentlich in ihm steht, sonst hätte er nicht geschrieben werden müssen. Will man trotzdem wissen, was in einem Roman eigentlich steht, muß man auf den Schluß achten. Da leuchtet am allerehesten das den Interpreten glücklich machende „fabula docet“ auf. Der Schluß von „Fremde Leute“ irritiert: Hat es eine Entwicklung, eine Emanzipation gegeben vom vorpubertären Mädchen zur Konfirmandin und dann zur flüchtigen Studentin? Ist das Kind entkommen, hat es die Vorgeschichten hinter sich gelassen? Der Roman beginnt mit der Furcht der Eltern vor fremden Leuten und endet mit der selben Angst des Kindes vor „Fremden Leuten“, die auch den Roman- Titel diktiert. Ist Erwachsenwerden Emanzipation von den familiären Prägungen oder deren Fortsetzung? Der zum Anfang zurückkehrende Schluß verschlingt die durch ihre abgeschlossenen und zukunftshoffenden Geschichten unterschiedenen Generationen wieder. Wieweit ist unser Leben gestaltbar oder unverfügbar ererbt? Das nun erwachsene Kind wiederholt das Verhalten der Eltern, will wie diese nichts als seine Ruhe: „Ich habe mein Zimmer. Und meine Ruhe. Ich habe nicht gern fremde Leute im Haus“ (S. 175)
So schon die Mutter, die im grandiosen Roman-Anfang sich totstellen will gegen das Klingeln der reichen Klassenkameradin des Kindes, denn „Fremde Leute“ ist auch ein sozialer Roman: „Meine Mutter hatte nicht gern fremde Leute im Haus.“ (S. 8)
Aber danach kommt der letzte Satz des Romans, als das Kind endlich sein eigenes Zimmer hat: „Und wenn ich mich in das Fenster stelle, habe ich den Himmel über mir, blau:“ (S. 175) Ist also das eigene Leben doch gestaltbar gegen die Schatten familiärer Prägung und deutscher Biographie-Vernichtungen? Sind wir doch Souveräne unseres Lebens bei aller groß- und kleinhistorischer Determinierung?
Warum gibt es immer wieder Wellen von literarischen Kindheits-Aufarbeitungen? Sie kommen besonders zur Zäsurzeiten: 1968, 1978, 1989, zur „Generation Golf“ 2000. Wo sozialer, kultureller Wandel empfunden wird, setzt offenbar die Notwendigkeit ein, sich des eigenen Herkommens zu erinnern, sich der Generationsidentität zu vergewissern. Dies mit zwei Tendenzen: Einmal, um die junge Generation gegenüber den älteren zu profilieren; zum andern, um den jüngeren Generationen das Eigene der älteren entgegenzuhalten. Literarische Erinnerungen als Teil von Generationskonkurrenzen. Daß sich mit Anna Breitenbach, Ulla Hahn, Peter Roos und anderen die Nachkriegsgeneration im Roman jetzt verstärkt zu Wort meldet, mag daran liegen, daß sie daran erinnern möchte, daß die Deutschen der Berliner Republik, Ost wie West, ihre eigenen, gemeinsamen wie jeweils unterschiedlich verwickelten Vorgeschichten haben, die eine Kriegs- und Faschismusgeschichte ist. Sie erinnern sich und mit sich daran, daß im Euro- Land deutsche Biographien und Mentalitäten ihre immer noch ganz besonderen Konditionen haben – beziehungsweise, daß diese nicht – um den Preis des Mißverstehens der deutschen und dann deutsch-deutschen Sonderlichkeiten – so einfach vergessen werden sollten.
Anna Breitenbach hat viel Zeittypisches, Soziales, Geschlechtsspezifisches auf einen literarischen Nenner gebracht, was mir älterem Nachkriegskind einen Wiedererkennungsrausch gab. Aber auch einen Erkennungsrausch, der mit Geschichte weniger zu tun hat. So erzählt sie im Kapitel „Meine Stimme“ von der fürchterlich Atemnot beim Vorlesen:
„Ich war ganz allein. Und es gab keine Rettung. Alle hörten zu. Ich konnte nicht weg. Und ich konnte nicht sagen: Ich kann nicht mehr. Ich mußte weitermachen mit der Stimme, die nicht mehr konnte. Und das Herz auch nicht.“
Oh, wie kenne ich das! Wir sind uns zwar „Fremde Leute“. Daß aber nicht nur, dazu kann eine Literatur wie die von Anna Breitenbach verhelfen.
Ich gratuliere Anna Breitenbach!
Verleihung des Thaddäus-Troll-Preises am 10. November 2001 im Literaturhaus Stuttgart, Laudatio Dr. Hermann Kinder Konstanz